

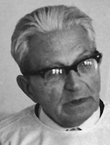
Wie unvergleichbar schwerer die Situation der Juden jener Zeit in den kleinen Orten war, mag das Folgende zeigen.
Am Jom Kippur-Abend des Jahres 1937 bat mich der junge Kollege Sommerfeld dringend um einen Besuch bei seinem plötzlich schwer erkrankten Vater in Schneidemühl in der Grenzmark. Der Vater war der Vorsitzende der dortigen jüdischen Gemeinde. Da es sich, wie die Darstellung ergab, um einen Fall von Leben oder Tod handelte, fuhr ich hin und untersuchte um Mitternacht den Kranken, dessen Zustand in der Tat so bedrohlich war, dass ich eine sofortige Operation am Orte für notwendig erklärte. Die einzige vorhandene Privatklinik lehnte mein Ansuchen, in ihren Räumen die Operation durchzuführen, mit dem Hinweis ab: Juden nähme man nicht auf. Zum Glück war in dieser Nacht der als grober Antisemit bekannte Chefchirurg des dortigen Städtischen Hospitals verreist. Der junge Oberarzt der chirurgischen Abteilung, in Naziuniform, der mich dem Namen nach von Berlin her kannte, benahm sich aber korrekt. Er bedauerte zwar, mir selbst die Durchführung des Eingriffs nicht übertragen zu dürfen, war jedoch zur Durchführung der Operation in meiner Gegenwart bereit. Die sofortige Hilfe rettete dem Patienten das Leben. Der junge Mediziner, für den das wohl die erste Operation dieser Art darstellte, bedankte sich sogar für meinen während der Operation erteilten Rat.
In später Nachtstunde, vor meiner Heimreise, erzählten mir die Angehörigen des Patienten vom „Leben” der kleinen jüdischen Gemeinde in Schneidemühl. Die Stadt war immer eine der Hochburgen des Antisemitismus in der Grenzmark gewesen. In dieser Jom Kippur-Nacht brannten nur wenige Kerzen in der Synagoge, weil die kleine dort versammelte Gemeinde jedes Aufsehen vermeiden wollte. Während des Gottesdienstes machte der Pfarrer der örtlichen evangelischen Bekennenden Kirche mit seinem Küster die Wachrunde um die Synagoge, um die Juden vor etwaigen Angriffen zu bewahren. Tote konnte man, so erzählten mir meine Gesprächspartner, nur noch heimlich nach Anbruch der Dunkelheit beerdigen. Denn würde man es bei Tage tun, so würden „christliche” Jugendliche vor dem Leichenzug einhertanzen, um laut johlend ihrer Freude darüber Ausdruck zu geben, dass wieder ein Jude weniger auf der Welt sei! Auch die Lebenden gingen übertags kaum noch ins Freie.
Zu der plötzlichen schweren Erkrankung meines Patienten hatte erheblich eine unaufschiebbare Reise nach Berlin, zwei Tage zuvor, beigetragen. Er war in seiner Eigenschaft als Gemeindevorsteher in die Hauptstadt gefahren, um im Innenministerium vorzusprechen. Grund für diesen schweren Gang war das ungeheuerliche Ansinnen der örtlichen Nazibehörden an die jüdische Gemeinde, binnen vierzehn Tagen die Toten des alten jüdischen Friedhofs dort zu exhumieren und andernorts wieder beizusetzen. Die Nazibeamten des dem Friedhofsgelände benachbarten Regierungsgebäudes hatten nämlich erklärt, der tagtägliche Anblick von Judengräbern sei ihnen nicht zuzumuten. Zwar erreichte Sommerfeld beim Innenministerium die Rücknahme der unmenschlichen Verfügung, kehrte aber krank von den Aufregungen heim.
Seit der Machtübernahme durch die Nazis wurden die Juden Deutschlands Zeugen und Opfer einer Flut von Verordnungen und Gesetzen, die von ihrer Deklassierung als „Nichtarier”, über ihre Ausschaltung aus der Beamtenschaft und dem Studium, über ihre Separierung durch die „Nürnberger Gesetze” (15.9.1935) als „Staatsangehörige” ohne „Reichsbürgerrecht”, schließlich zur Entfernung aus allen Berufen führten. Für die jüdischen Ärzte kam der Schicksalsschlag mit der Vierten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. Juli 1938, durch die ihnen, mit Wirksamkeit vom 30. September des gleichen Jahres, die Approbation genommen wurde. Ausnahmen blieben nur „auf Vorschlag der Reichsärztekammer” jedoch „widerruflich” gestattet. Allen jüdischen Ärzten, die keine solche befristete Genehmigung erhielten, war fortan „verboten, die Heilkunde auszuüben”. Und selbst wenn eine Sondergenehmigung vorlag, durfte der jüdische Arzt „nur Juden behandeln”. Diese Verordnung unterzeichnete „Der Führer und Reichskanzler” sinnigerweise in Bayreuth!
Den jüdischen Zahnärzten, Tierärzten und Apothekern wurde die Approbation mit der Achten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 17. Januar 1939 entzogen, die zudem noch dekretierte, dass jüdische „Hilfskräfte in der Gesundheitspflege” nur unter Juden tätig sein dürften.
Vorausgegangene Maßnahmen der Nazis hatten dies zwar erwarten lassen, dennoch trafen diese Verordnungen die meisten von uns, besonders aber die älteren Jahrgänge, wie ein Schock. Wer ein Menschenalter hindurch den Arztberuf ausgeübt hatte, mit dem für ihn so besonders entwickelten Bewusstsein der beruflichen Pflicht und Sendung — weit über den Erwerbsgesichtspunkt hinaus, konnte schwerlich verstehen, dass ihm von nun ab im Deutschen Reich „verboten” war, Menschen zu helfen. Die daraus sich ergebenden Erschütterungen nahmen denn auch bei vielen alten Ärzten tragische Formen an, besonders bei denen, die sich in der Illusion wiegten, das Verbot beträfe gerade sie persönlich aus irgendeinem Grunde nicht.
Vor Erlass dieser Gesetze hatte weithin die Vorstellung bestanden, auch ein Naziregime werde — mindestens im Kriegsfalle — nicht auf die jüdischen Ärzte verzichten wollen, zumal sich unter ihnen eine große Zahl befand, die im ersten Weltkrieg frontärztliche Erfahrungen gesammelt hatte. Diese Meinung scheint auch in Offizierskreisen eine gewisse Zeit lang verbreitet gewesen zu sein. Als die Provokationen der Nazis gegenüber der Tschechoslowakei die Kriegsgefahr akut werden ließen, berief der Generalarzt der deutschen Armee die leitenden Chirurgen der Berliner Krankenhäuser (darunter einen mir befreundeten Kollegen, von dem ich diese Information erhielt) zu einer dringenden geheimen Sitzung zusammen, um den Stand der Vorbereitungen im Feldsanitätswesen für den Kriegsfall zu besprechen. Es stellte sich dabei heraus, dass von wirklichen Vorbereitungen in diesem Bereich keine Rede sein konnte, was auch „von oben” zugegeben wurde. Als einer der geladenen Ärzte darauf hinwies, dass man gegebenenfalls frühere jüdische Abteilungschefs an die Krankenhäuser zurückberufen müsse, wenn die „arischen” Kollegen zum Felddienst eingezogen würden, bemerkte der militärische Vorsitzende, man habe darüber zwar schon gesprochen, sei aber bisher zu keiner Entscheidung gekommen. Dann erfolgte das Berufsverbot für uns, möglicherweise mit davon beeinflusst, dass das unterdessen geschlossene Münchener Abkommen den Krieg vermeidbar, jedenfalls nicht unmittelbar bevorstehend und unseren Einsatz daher als überflüssig erscheinen ließ.
Für die Betreuung der noch nicht ausgewanderten Juden — zur Zeit der Verhängung des Berufsverbots für jüdische Ärzte noch etwa die Hälfte der ehemaligen deutschen Judenheit — wurde eine begrenzte Anzahl von Ärzten „neu zugelassen”. „Berücksichtigt” wurden hierbei von der zuständigen Nazibehörde nur Anträge von jüdischen Ärzten, die mit nicht-jüdischen Frauen verheiratet oder, besonders unsinnig und zynisch, in besonders hohem Alter (zwischen 70 und 80 Jahren) standen. Viele jüngere und qualifizierte Fachärzte blieben ausgeschlossen.
Ich entsinne mich noch genau der nervenzermürbenden Wartezeit, in der Telefonanrufe zwischen uns hin und hergingen, durch die wir unter den Kollegen zu erfahren suchten, wer denn nun Antwort auf sein Gesuch in positivem oder negativem Sinne erhalten habe. Manche der Kollegen bewarben sich gar nicht erst um diese „Wiederzulassung”.
Schon nach Veröffentlichung des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums”, durch das die Nichtkriegsteilnehmer von 1914—18 unter uns von der Kassenpraxis ausgeschlossen wurden, hatten wir jüdischen Kollegen beraten, ob wir nicht aus Solidaritätsgefühl für die betroffenen Ärzte kollektiv auf weitere Ausübung der Praxis verzichten sollten. Ein solcher damals gefasster Entschluss hätte, so könnte man denken, weit mehr als nur eine moralische Bedeutung gehabt. Vielleicht wäre seine Folge gewesen, dass sich zu einem Zeitpunkt, da dies noch möglich war, eine weit größere Zahl jüdischer Ärzte zur Auswanderung entschlossen hätte, statt sich Illusionen über Privilegien hinzugeben, die den Auflösungsprozess des jüdischen Arzttums in Deutschland nur verzögerten und die physische Vernichtung der Gutgläubigen am Ende nicht verhinderten. Bei solcher Überlegung vergisst man aber die große Zahl der noch in Deutschland verbliebenen Juden, die ärztlicher Hilfe bedurften. Zwar konnten sie diese anfänglich auch noch von nicht-jüdischen Ärzten erhalten, bald aber waren sie ausschließlich auf jüdische Ärzte angewiesen.
Von den wenigen mir bekannten Ausnahmefällen, in denen nicht-jüdische Ärzte trotz der ihnen drohenden Repressalien jüdische Patienten auch weiterhin behandelten, möchte ich die folgenden hervorheben: Mein Lehrer, der Ophtalmologe Professor Krückmann, vormals Ordinarius für Augenheilkunde an der Berliner Universität, behandelte bis zuletzt ohne Rücksicht auf Nazikritik jüdische Patienten, oftmals ohne Honorar, und besuchte sogar, wie ich aus zuverlässiger Quelle erfuhr, einmal eine jüdische Patientin im Gefängnis, als sie wegen angeblicher Devisenvergehen verhaftet wurde.
Hilfreich blieb auch der Chirurg Professor Otto Nordmann, ein alter Demokrat, der seine Stellung als leitender Chirurg am Städtischen Krankenhaus Berlin-Schöneberg aufgegeben hatte und Chefchirurg des konfessionellen Martin-Luther-Krankenhauses wurde, weil — wenigstens anfangs — dort die Nazidoktrinen noch nicht Eingang gefunden hatten. Ebenso menschlich erwies sich ein anderer Chirurg, Professor Erwin Gohrbandt, mit dem mich bis heute enge freundschaftliche Beziehungen verbinden; das gleiche gilt für Professor Georg Hohmann, München, den großen Arzt und Humanisten. Erwähnt sei auch, dass das Katholische Krankenhaus in der Grossen Hamburger Straße noch spät und ohne Einschränkung jüdische Patienten aufnahm und ausgezeichnet behandelte.
Schließlich sei hier noch eines Mannes gedacht, der durch die mutige und selbstlose Hilfe, die er einem Juden leistete, seinen Posten am Rudolf Virchow-Krankenhaus verlor. Dieser, Professor Anders, hatte die Obduktion des von den Nazis bestialisch gefolterten jüdischen Kaufmanns Neumann auszuführen, der, aus Königsberg in hoffnungslosem Zustande in die Normannsche Klinik gebracht, dort seinen Verletzungen erlag. Der Fall erregte damals allgemeines Aufsehen und Entsetzen. Das Sektionsprotokoll wurde dringend von der Verteidigung eines meiner Verwandten angefordert, der wegen Verbreitung von „Gräuelmärchen” verhaftet worden war. Er hatte die Unvorsichtigkeit begangen, einem ihm Unbekannten gegenüber kritische Bemerkungen über diesen Fall Neumann zu machen, und war von ihm denunziert worden. Der „Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens”, dessen energische Bemühungen um seine jüdischen Mitbürger in dieser Zeit alles Lob verdienen, fand mit Mühe einen christlichen Anwalt in Königsberg, der mit für die damalige Zeit bemerkenswertem Mut die Verteidigung übernahm. In dem unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Prozess in Bingen kam der Angeklagte mit einer relativ milden Strafe weg, sicherlich wohl nur dank der Tatsache, dass der mutige und unerschrockene Professor Anders dem Verteidiger das Sektionsprotokoll zur Verfügung gestellt hatte, das die Wahrheit der vom Angeklagten aufgestellten Behauptungen über die Misshandlungen unwiderlegbar bewies. Professor Anders allerdings wurde, wie gesagt, für diese selbstlose Handlung bestraft, indem er seinen Posten verlor.
Die oben bereits beschriebene Handhabung der Auswahl von jüdischen Ärzten zur „Neuzulassung” war nicht nur deshalb untragbar, weil so viele der besten Ärzte von jeder Berufsbetätigung ausgeschlossen blieben, sondern auch in Hinblick auf die völlig unzureichende Zahl verfügbarer Ärzte für die allgemeine wie fachärztliche Versorgung der jüdischen Bevölkerung überhaupt. Den vorbildlichen Bemühungen Heinrich Stahls, des unvergesslichen Vorsitzenden der Berliner Gemeinde, zusammen mit denen Professor Seligmanns war es zu verdanken, wenn schließlich so viele Fachärzte und Kliniker noch zugelassen wurden, dass wenigstens in den Gemeinde-Polikliniken und im Krankenhaus wieder qualifizierte Chefärzte und Assistenten arbeiten konnten. Ich besitze noch die sogenannte „Gestattung”, die Wiederzulassungsurkunde aus jenen Tagen, ein in Form wie Inhalt bemerkenswertes Dokument nationalsozialistischer Brutalität. Eine Anrede trägt die Urkunde nicht, unterzeichnet ist sie von einem untergeordneten Beamten, erteilt war sie auf Widerruf. Der Neuzugelassene heißt „Behandler”, nicht mehr Arzt. Er darf nur noch Juden behandeln. Auf jedes Schriftstück, Rezept, Brief oder Kuvert war dies an sichtbarer Stelle aufzudrucken. Vor den Aufdruck musste ein Davidstern umgeben von einem Kreis gesetzt werden.
Namensschilder am Haus waren zwar gestattet, mussten aber in der linken oberen Ecke einen blauen Davidstern in gelbem Kreis in vorgeschriebener Größe zeigen. Die Farbe des Schildes hatte lichtblau zu sein, die Beschriftung — wiederum in vorgeschriebener Größe — hatte den Inhaber als Behandler ausschließlich für Juden zu kennzeichnen. Selbst die Größe des Schildes war in Zentimetern genau angegeben. Für die Anbringung dieser Schilder war eine so kurze Frist gesetzt (Nichtbefolgung führte automatisch zu Streichung der Zulassung!) dass, ohne geeignete Vorbilder und infolge des Mangels an Material und willigen Schildermalern, manche Kollegen große Mühe hatten, diese Kennzeichnung rechtzeitig am Hause anzubringen. Da mein Schild nicht „fristgemäß” fertig wurde, fertigte mir ein hilfreicher junger Mann ein den Vorschriften einigermaßen entsprechendes Pappschild an, das anfänglich aushilfsweise zu dienen hatte.
Der Anblick dieser Schilder hatte sehr unterschiedliche Wirkung auf die überraschte Bevölkerung. Das Deutsch des vorgeschriebenen Schild-Textes war unklar genug, noch vereinzelte nicht-jüdische Patienten in die Sprechstunde jüdischer Ärzte zu bringen. Es war nicht immer leicht, sie unter den jüdischen Kranken auszusortieren, zumal mir Fälle bekannt sind, in denen „arische” Patienten sich als Juden ausgaben, um weiter von jüdischen Ärzten behandelt zu werden. Da aber auch mit Provokateuren zu rechnen war, die uns Vergehen gegen die Nazigesetze nachweisen und damit den Verlust der Praxis erzielen sollten, beschlossen wir, uns von den Patienten schriftlich bestätigen zu lassen, dass sie nach dem Rassengesetz Juden seien. Die meisten von uns bedienten sich dazu vorgedruckter Formulare, die wir grundsätzlich jedem zur Unterschrift vorlegten.
Zu den unverständlichsten Beschränkungen für jüdische Ärzte gehörte das Verbot der Anlegung von Bakterienkulturen und die Durchführung der Wassermannschen Reaktion. Besonders der Sinn des ersteren ist nie klar geworden. Wollte man verhindern, dass wir durch solche Untersuchungen Geld verdienten? Oder redete man sich in der Tat ein, wir könnten am Ende Bakterienkulturen zur Vergiftung von „Ariern” verwenden? Dachte man damals etwa gar an einen künftigen Bakterienkrieg? Wir haben die Antwort nie erfahren.
Charakteristisch für die ambivalente Haltung der nicht-jüdischen Bevölkerung unserem Schicksal gegenüber erschien mir folgende Episode. Meine letzte nicht jüdische Patientin verabschiedete sich von mir im September 1938. Nachdem sie die Rechnung bezahlt und sich für meine Hilfeleistung bedankt hatte, ging sie mit der Bemerkung hinaus: „Ich möchte Ihnen, Herr Doktor, der sie so hilfreich zu mir waren, noch sagen, dass mein Mann und ich gegen die Judengesetze sind. Mein Mann sagte immer: ‚Hat man sie so lange geduldet, da hätte man sie auch weiter dulden können’.” Dieser wohl im Grunde gut gemeinte Ausspruch einer einfachen Frau hat manches gemein mit einem anderen, den man damals oft hörte, wenn gesagt wurde: „Die alteingesessenen Juden hätte man doch schonen sollen. Mit den nach dem ersten Weltkriege Eingewanderten ist es eine andere Sache.”
Über diesen Unheilstag in der Geschichte der deutschen Juden ist so viel schon geschrieben worden, dass ich mich hier auf Vorgänge aus dem Bereich ärztlicher Tätigkeit beschränken darf. Auf eine Gelegenheit, gegen die Juden vorzugehen, hatten die Nazis schon lange gewartet. Mehr als ein willkommener Anlass war daher die Erschießung des Gesandtschaftsrats vom Rath in Paris durch Herschel Grynspan nicht. Mir selbst bestätigte diese Feststellung eine christliche Freundin, indem sie mir mitteilte, ein ihr bekannter Staatsanwalt habe schon geraume Zeit vor dem Pogrom die für Aufnahme von Juden bestimmten Konzentrationsläger im Regierungsauftrag inspiziert, um festzustellen, ob alles vorbereitet sei. Die ersten Festnahmen von Juden wurden uns in Berlin am Nachmittag des 9. November bekannt. Die meisten Verhaftungen erfolgten aber am 10. November und an den darauf folgenden Tagen. Die Hauptzahl der Unglücklichen setzte sich aus Begüterten, bzw. führenden Personen der Wirtschaft, und aus Angehörigen der freien Berufe zusammen, unter diesen natürlich viele Ärzte. Die Festgenommenen wurden vorwiegend in die Läger Buchenwald bei Weimar und Oranienburg bei Berlin gebracht, genauer gesagt nach dem seither in die Schreckensgeschichte eingegangenen Lager Sachsenhausen. Wenn sich unter den Berliner Verhafteten ungewöhnlich viele Ärzte befanden, geht man wohl in der Annahme nicht fehl, dass die Nazis das vorsätzlich taten, in vollem Bewusstsein, damit einer großen Zahl jüdischer Kranken die ärztliche Hilfe zu nehmen.
Da mich am Nachmittage des 9. November ein Kollege telefonisch gewarnt hatte, verbrachte ich die Nacht zum 10. bei einer verwitweten Verwandten, wie sich auch sonst in diesen Tagen viele jüdische Männer bei alleinstehenden Frauen verbargen, da die Suchkommandos nicht nach Frauen fahndeten. Bedrohte Personen benutzten ihre Privattelefone nicht, sondern öffentliche Fernsprechstellen. Da diese infolgedessen die ganze Nacht hindurch umlagert waren, hätten sie den Nazis eigentlich die Einfangarbeit erleichtern können, aber zu diesem Termin suchten sie nur aufgrund von Listen, statt — wie später — Straßen, Bahnhöfe und öffentliche Verkehrsmittel nach Juden durchzukämmen.
Der Sucheifer der Fahndungsbeamten nach den auf den Listen eingetragenen Opfern war unterschiedlich. In manchen Fällen kamen sie nicht wieder, wenn sie beim ersten Male das Opfer nicht antrafen, in anderen Fällen wiederholten sie den „Besuch”. Meine Frau bedrohten sie damit, dass sich meine Lage verschlimmern würde, wenn sie die Auskunft über meinen Verbleib verweigere. Ein alter Sanitätsrat entging nur knapp seinem Schicksal. Als er bei Rückkehr in seine Wohnung hörte, dass man nach ihm gefragt habe, begab sich der „gute Staatsbürger” aufs nächste Polizeirevier, um den Zweck der „Nachfrage” zu erkunden. Mit Mühe konnte ihm der diensthabende alte Polizeibeamte klar machen, dass er an der Frage überhaupt nicht interessiert sei, der Fragesteller aber schleunigst das Revier verlassen solle, und zwar — ohne nach Hause zu gehen. Manchen der mit dieser Menschenjagd beauftragten Beamten war ihre Aufgabe sichtlich unangenehm und sie suchten die Angehörigen damit zu trösten, dass der Familienvater bald wieder entlassen werde. In einigen seltenen Fällen gaben diese Beamten den zu Verhaftenden sogar Gelegenheit, sich in Sicherheit zu bringen. Viele Männer irrten in diesen Tagen und Nächten in Vorstadtstraßen, in denen sie kein Erkennen zu befürchten hatten, umher, vor allem aber im Grunewald, oder aber sie wechselten dauernd ihr Quartier.
Unter solchen Zuständen war es selbst den noch in Freiheit befindlichen Ärzten kaum mehr möglich, ihre Berufspflichten zu erfüllen. Und wie groß war denn überhaupt, selbst für die Mutigsten, die Bewegungsfreiheit, wenn SS-Wachen und „Rollkommandos”, im Schatten von Häusern und Bäumen postiert, jeden als Juden „verdächtigen” Abend-Passanten anhielten, um ihn, falls der Verdacht sich bestätigte, fortzuschleppen? Mich rief man in der Nacht vom 9. zum 10. November auf telefonischen Umwegen dringend zu einer kleinen Patientin in einem Vorort von Berlin-W. Das Kind war mit seiner Familie aus Nürnberg nach Berlin geflüchtet. Nach mühevollem Fußmarsch, ständig SS-Streifen ausweichend, kam ich ans Ziel. Ich konstatierte eine bereits durchgebrochene Blinddarmentzündung, die eigentlich unverzüglich hätte operiert werden müssen. Das war aber — besonders aus Transportschwierigkeiten unter den herrschenden Bedingungen — unmöglich. Erst gegen Mittag des folgenden Tages konnte ich den Eingriff vornehmen, der dem Kinde eben noch das Leben rettete. Kurz vor meinem Eintreffen in der Wohnung der kleinen Patientin hatte man deren Vater verhaftet. Während ich die Operation vornahm, erschien in meiner Wohnung ein Kommando, das mich verhaften sollte, fand mich aber aus diesem Grunde nicht vor und kam nicht wieder. So rettete das Kind mich.
In diesen furchterfüllten Tagen wurden jüdische Privatkliniken und Krankenhäuser zu Zufluchtsstätten Gefährdeter. Bald konnte man aber niemanden mehr aufnehmen. Menschen mit alten Leiden, die keiner dringenden chirurgischen Behandlung bedurften, erbaten flehentlich die Operation, weil sie — als Operierte — vor dem Zugriff der Häscher sicher zu sein glaubten. Das Risiko einer schweren Operation erschien ihnen ein Vorzug, gemessen an dem des Abtransports in ein Konzentrationslager. Während nun wirklich in Berliner jüdischen Kliniken nicht gesucht wurde, ging es in der Provinz ganz anders zu. Aus Breslau beispielsweise wurde mir berichtet, wie man Kranke, deren Temperatur 38 Grad nicht überstieg, schonungslos herausholte, ja selbst frisch Operierte. Der Gauleiter von Schlesien trieb hemmungslos sein Unwesen.
Über den 10. November, den Reichs-Pogromtag, will ich hier nur eine selbsterlebte Szene mitteilen. Der Morgen dieses Tages verwandelte die Stadt Berlin in ein Tollhaus, regiert von den durch Kapuzen unkenntlich gemachten Banden, die Julius Streicher eigens für diese Großaktion geschickt hatte. Die maskierten Vandalen hatten im Vorhinein nach ihren Listen die jüdischen Firmen durch schmähende Beschriftungen kenntlich gemacht. Nun zogen sie mit Eisenstangen los und begannen ein blindes Zerstörungswerk, zuerst der Schaufenster, dann des Inventars der Geschäfte, begleitet von Plünderungen. Der Polizei war jedes Eingreifen untersagt worden und sie sah dem wüsten Treiben zu, wie ja auch dem Brennen der Synagogen. Die Bevölkerung Berlins beteiligte sich so gut wie gar nicht an den Zerstörungen, stand nur in dichten Haufen stumm und staunend da. Die wenigen, die ihrem Unwillen Ausdruck gaben, wurden verhaftet.
Meine damalige Arbeitsstätte, die Poliklinik der Jüdischen Gemeinde am Alexanderplatz, war ebenfalls weitgehend verwüstet werden. Die ersten Angestellten, die morgens eintrafen, um die Klinik zu öffnen, fanden eine Stätte vandalischer Zerstörung vor und riefen mich telefonisch herbei. Ich fand das Personal — soweit es hatte kommen können — versammelt, aber in völlig verstörter Verfassung. Von dem mit großer Liebe und Mühe aufgebauten Institut war außer den nackten Wänden und Teilen der Röntgen- und physikotherapeutischen Abteilung kaum noch etwas heil. Die einzige „Rücksicht”, die die Vandalen genommen hatten, bestand darin, dass sie die Klinik nicht auch noch in Brand gesteckt hatten (und das nur dank des Umstandes, dass sie im Mittelbau eines großen Fabrik- und Geschäftshäuserblocks in der zweiten Etage lag, also umgeben von nicht-jüdischem Besitz.) Man hatte das schwere eiserne Eingangstor des Instituts aufgesprengt, den größten Teil des Mobiliars zerschlagen und sogar die große, über Jahre sorgsam geführte, Krankenkarthotek vernichtet. Massen zerfetzter Blätter türmten sich mit den Trümmern der Klinikeinrichtung unten auf den Höfen, wohin man durch die Fenster alles, was nicht niet- und nagelfest war, geworfen hatte. Die Poliklinik war funktionsunfähig geworden.
Was würde wohl der junge indische Gast-Arzt zu diesem Anblick gesagt haben, dem schon früher einmal eine antisemitische Szene in der Klinik den Ausruf: „Wie im Dschungel” abgerungen hatte? Ein alter nicht-jüdischer Schlossermeister, der gerufen wurde, die Eingangstüren wenigstens wieder abschließbar zu machen, schlug bei dem Anblick die Hände zusammen: „Wenn ich das nicht selbst gesehen hätte, würde ich es nicht glauben.”
Mein beschäftigungslos gewordenes Personal wurde, soweit möglich, auf verschiedene Abteilungen des Gemeindekrankenhauses Iranische Straße verteilt.
Noch in der Poliklinik erreichte mich die dringende Aufforderung des Gesundheitsamtes der Gemeinde, die Leitung der Chirurgischen Abteilung des Gemeindekrankenhauses zu übernehmen. Dem bisherigen Leiter, Professor Paul Rosenstein, der schon lange vorher den Wunsch geäußert hatte, ich solle einst sein Nachfolger werden, war es — in schwer gefährdeter Position — gerade noch gelungen, aus Deutschland herauszukommen. Das Krankenhaus war von den Ausschreitungen unberührt geblieben, seine Ärzteschaft und sein Personal jedoch in höchst gedrückter Stimmung. Professor Albert Salomon, den Leiter der Chirurgischen Poliklinik des Hauses, hatte man nach Oranienburg verschleppt, mehrere leitende Ärzte, Assistenten und Schwestern standen vor der Auswanderung. Eine große Hilfe für mich bei Übernahme meines Amtes war der eben eingesetzte Administrator Triest, ein umsichtiger, allen Verbesserungsvorschlägen offener Mann, der sein bei Dienstantritt gegebenes Wort, er werde nicht auswandern und alles für die Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebes erforderliche tun, hielt und sich in stillem Heldentum dieser Aufgabe zum Opfer brachte. Ihm gebührt ehrendes Andenken.
Der fortdauernde Ausfall erprobter Ärzte und Schwestern war kaum noch durch neue Kräfte auszugleichen. Das besonders drückende Problem des Ersatzes für Operationsschwestern wurde teilweise durch Wiedereinstellung altgedienter Schwestern, die aus Heiratsgründen z. T. schon lange zuvor den Dienst verlassen hatten, gelöst. Die Zunahme der jüdischen Patienten aus Berlin selbst, wie nun auch aus der Provinz, erzwang eine wesentliche Erweiterung der chirurgischen Abteilung, die (einschließlich der urologischen Abteilung) 150 Betten erreichte. Unter großen Schwierigkeiten konnte die Zentralwäscherei wieder zur vollen Funktion gebracht werden. Besonders gefährdet war aber die Zufuhr der erforderlichen Medikamente. Eine von den Nazibehörden geplante Schließung unserer Hausapotheke konnten Professor Seligmann und ich nur mit Mühe verhindern, die Medikamentenbelieferung aber wurde immer schwieriger. Teils fürchteten die Lieferanten den Kontakt mit Juden und benutzten beispielsweise Lieferwagen ohne Firmenaufschrift, teils aber passte ihnen die direkte Beziehung zu Juden nicht mehr, wie etwa der — arisierten — „Hageda”, der Handelsgesellschaft deutscher Apotheker, die mir im September 1938 die Jahre hindurch in einem ihrer Häuser innegehabte Wohnung nach Verlust meiner Approbation einfach kündigte. Sie zog diese Kündigung auch nicht zurück, als sie dazu nach meiner Wiederzulassung durchaus imstande gewesen wäre. Jetzt schickte sie ihre Medikamentenvertreter zu uns durch die Hintertür. Auf jüdisches Geld verzichten, so weit wollte man doch wieder nicht gehen!
Der damalige Leiter der gynäkologischen und geburtshilflichen Abteilung des Krankenhauses war Dr. Siegbert Joseph, der früher zu gleicher Zeit mit mir Assistent am Krankenhaus Moabit gewesen war. Nach Ende des zweiten Weltkrieges erfuhren wir von seinem tragischen Tode während eines russischen Bombardements des Konzentrationslagers Libau.
Das Laboratorium leitete Professor Martin Jacoby, vorher in gleicher Stellung in Moabit, ein ebenso vorzüglicher Wissenschaftler wie Mensch. Die Röntgenabteilung unterstand Dr. Joseph Ziegler. Direktor der Inneren Abteilung war der als Forscher und Erfinder des Rektoskops weltbekannte Geheimrat Professor Hermann Strauss, der nach Theresienstadt deportiert wurde und dort wenige Monate vor der Befreiung starb. An leitenden Ärzten seien weiterhin genannt: der bedeutende Hämatologe Professor Hans Hirschfeld (ebenfalls nach Theresienstadt deportiert), der Kinderarzt Dr. Orgler, sein Nachfolger Dr. Oskar Rosenberg (der Theresienstadt überlebte und jetzt, hochbetagt, Direktor des Jüdischen Krankenhauses in Berlin ist), die Ohrenärztin Dr. Else Levy (die in ihrem Versteck verraten wurde und umkam) und Dr. Paul Meier, früherer Oberarzt der Strassmannschen Klinik, den seine christliche Frau durch die Jahre 1940—1945 rettete, der dann Leiter der Frauenabteilung des Schöneberger Krankenhauses wurde und heute in hohem Alter in West-Berlin lebt.
Die Auswanderung vieler leitender Ärzte der Gemeindepoliklinik — oder „Krankenhilfe”, wie sie sich nur noch nennen durfte — am Alexanderplatz und der Poliklinik des Krankenhauses machte eine geregelte Arbeit infolge des dadurch hervorgerufenen häufigen Personalwechsels natürlich äußerst schwierig. Nur wenige von den altgedienten Schwestern blieben auf ihren Posten. Besonders erwähnen möchte ich die Oberschwester Rita Stein (chirurgische Abteilung), die Oberschwester Rosa Heimann (urologische Abteilung) und die Oberschwester der Privatstation Friedel Reichmann mit ihren exemplarischen Leistungen. Mit Mühe gelang es mir, diese drei ausgezeichneten Mitarbeiterinnen zur Auswanderung nach England zu bewegen, als die Lage für sie aussichtslos wurde. Schwester Rosa wurde vor einigen Jahren in Israel von den hier lebenden ehemaligen Ärzten und Schwestern des Jüdischen Krankenhauses Berlin als geehrter Gast begrüßt. Schwester Friedel kam mit ihrer Tochter, die ebenfalls Schwester ist, 1948 nach Israel und lebt seit dieser Zeit im Lande.
Die Zentralorganisation der Krankenschwestern Englands hatte sich sogleich bereit erklärt, jüdische staatlich geprüfte Krankenschwestern aufzunehmen. Aus späteren Briefen solcher jüdischen Schwestern erfuhren wir, dass sie zwar bei Kriegsausbruch zunächst entlassen, dann aber, wegen des in England herrschenden Personalmangels in diesem Beruf, wieder eingestellt wurden. Die Hilfsbereitschaft der englischen Schwestern für ihre Refugee-Kolleginnen ging übrigens bis zu kostenloser Überlassung von Berufskleidung.
Die noch verbliebene jüdische Bevölkerung half unermüdlich mit Material- und Geldzuwendungen, besonders im Bereich der sozialen Einrichtungen der Gemeinde, für deren Fortbestand der Gemeindevorstand mit Heinrich Stahl an der Spitze mit Aufopferung sorgte. Trotz mannigfacher Umbildungen dieses Vorstandes beließen die Nazis Stahl im Amte bis zu seinem Abtransport nach Theresienstadt, wo er am 4.November 1942 starb. Welchen Respekt die Nazis vor ihm hatten, zeigt der Umstand, dass sie ihm wiederholt gestatteten, Auslandsreisen zu machen, die den Interessen der noch in Berlin verbliebenen Juden dienten. Unter den steigenden Sorgen der Gemeindeleitung — mit dem unerschütterlichen Heinrich Stahl als immer festem Pol — war die Fortführung des Krankenhausbetriebs eine der größten. Allein die finanzielle Belastung, die er dem Gemeinde-Etat auferlegte, war schon schwer genug. Hinzu kamen noch die immer unsinnigeren Schikanen mit ihren dauernden „Neuverordnungen”, die einen im buchstäblichen Sinne täglich vor ganz neue Probleme stellten. Der schon erwähnte Koordinator des Gesundheitswesens, Professor Seligmann, musste sich in allen Fragen, administrativen wie finanziellen, die Genehmigungen eines besonderen Nazibeauftragten einholen, der allerdings, soweit ich mich erinnern kann, die Verwaltung kaum behinderte.
Unter den uns belastenden Schikanen war eine besonders aufreizende. Auch im Krankenhaus hatte man eine „Nazizelle” etabliert, eine für alle jüdischen Betriebe, die „Arier” beschäftigten, vorgeschriebene Kontrollstelle. Im Krankenhaus arbeiteten seit Jahren nicht-jüdische Angestellte, wie z. B. der Maschinenmeister, der jetzt der Zellenleiter war. Wir mussten daher große Vorsicht üben, um Denunziationen zu vermeiden. Das Vorhandensein dieser Überwachungszelle, um nicht zu sagen: Spitzelzelle machte sich u. a. auch durch antisemitische Anschläge am Schwarzen Brett in der Krankenhauseinfahrt bemerkbar. Wir selbst waren von uns aus gezwungen, ein Warnungsplakat anzubringen, das jüdische Patienten und Besucher aufforderte, beim Verlassen des Krankenhauses den kürzesten, geraden Weg über den Fahrdamm auf die andere Straßenseite zu benützen. Draußen waren, nicht sichtbar für die Passanten, zwei Polizisten lediglich dazu postiert, diejenigen Fußgänger, die diese Anweisung nicht strikt befolgten und etwa quer über den Fahrdamm gingen, wegen der „Verletzung der Straßenordnung” mit Geldstrafe zu belegen. Diese mutwillige Judenverordnung war in zweifacher Weise eine gemeine Falle. Erstens war diese Straße fast immer menschenleer und auch kaum befahren, forderte also zu „Übertretung” der Vorschrift geradezu heraus, zweitens aber wurde eine solche Übertretung bei Juden mit einer Geldstrafe von 30 Mark geahndet (bei Nichtjuden betrug sie lediglich 5 Mark), mit der beabsichtigten Zugabe, dass der Betroffene in die Polizeiakten als „vorbestraft” eingetragen wurde.
Am 10. November 1938 übernahm ich die Chirurgische Abteilung des Krankenhauses. Meine Hauptmitarbeiter waren der Oberarzt Dr. Erich Fischer und der erste Assistent Dr. Hans Knapp. Das Haus war überfüllt mit Patienten, darunter einige Rabbiner, denen — bei der notorisch besonders gefährdeten Lage ihres Berufs — unser Haus als Zuflucht diente. Ihr Kommen und Gehen wurde für uns nachgerade zu einem Gradmesser der Verfolgungssituation draußen.
Nicht weniger stark belegt war die seit langen Jahren schon von Geheimrat Professor Strauss geleitete Innere Abteilung. Als ich Professor Strauss bei unserer ersten Begegnung mein Erstaunen und meine Bewunderung angesichts der ungewöhnlichen Arbeitsleistung in seinem Alter ausdrückte, sagte er voller Erregung: „Das letztvergangene Jahr mit seinen unaufhörlichen Aufregungen erst hat mich zum alten Manne gemacht. Täglich Selbstmordversuche, durch Gas und Schlafmittel, behandeln zu müssen, oftmals vergeblich, ist auch für den Stärksten zu viel.”
Mit Professor Strauss arbeitete ich in vorbildlicher Weise zusammen. Als ich ihn später nach Auswanderungsplänen fragte, lehnte er diesen Weg für sich, mit dem Hinweis auf sein Alter und die dreißigjährige Verbundenheit mit seiner Berliner Tätigkeit, entschieden ab. Bei einem Besuch in Palästina hatten ihn auch seine dort lebenden früheren Assistenten nicht zum Verbleiben überreden können. Die Erinnerung an die leider nur kurze Zeit der Zusammenarbeit mit diesem außerordentlichen Manne bleibt mir eine unvergessliche Auszeichnung.
Die Schließung fast aller jüdischen Krankenhäuser in der Provinz (mit Ausnahme von Breslau, Köln und Hannover) ließ das Arbeitspensum der chirurgischen Abteilung schnell anschwellen. Doch konnte ich einen geordneten Betrieb aufrecht erhalten. Unser Krankenhaus musste sich, wie alle Hospitäler, an Luftschutzübungen beteiligen, für die man uns auch 250 Gasmasken lieferte. Der „Ärzteführer” Dr. Conti besuchte, mit großem Gefolge, unser Krankenhaus und zollte „höchstpersönliche” Anerkennung unserer Verwaltungskunst. Einstweilen fanden auch immer noch in Gegenwart eines Regierungsvertreters die staatlichen Prüfungen für Absolventinnen der uns angegliederten Schwesternschule statt.
Diese Beispiele zeigen die typische Mischung von althergebrachter amtlicher Korrektheit mit brutalstem Verfolgungswillen, die für die Nazis charakteristisch war. Wenn, wie gesagt, Berlin von den Szenen der Verschleppung jüdischer Kranker aus den Hospitälern am Pogromtag verschont blieb, so wird dafür die Ursache wohl in der Anwesenheit vieler Ausländer zu suchen sein. Die gleiche unterschiedliche Behandlung der Juden in diesen Tagen zeigte sich ja auch darin, dass in der Provinz, über die Demolierung jüdischer Geschäfte weit hinaus, auch Privatwohnungen nicht geschont wurden, vor allem aber sehr viele Misshandlungen und Ermordungen gemeldet wurden. Verletzte Pogromopfer überführte man nach Möglichkeit in unser Krankenhaus. Nach meiner Erinnerung war der erste, der in diesem bejammernswerten Zustand aus der Provinz eingeliefert wurde, der Synagogendiener einer kleinen thüringischen Gemeinde, der einen, glücklicherweise nicht lebensgefährlichen, Brustschuss erhalten hatte. Er erzählte mir, wie es zu diesem gekommen war: Nazis, mit dem Ortsgruppenleiter an der Spitze, waren zunächst in die Synagoge eingedrungen und hatten sie in Brand gesetzt. Dann brachen sie in das nebenan liegende Gemeindehaus ein, in dem er mit seiner Familie wohnte, und ließen Frau und Kinder zusehen, wie sie ihn an die Wand stellten, der Gruppenführer ihm zunächst den Brustschuss, dann einen weiteren (der zufällig seine Taschenuhr traf) beibrachte, um ihn dann, da sie sahen, dass er noch lebte, auf die Straße zu zerren. Blutend wurde er von ihnen durch das Städtchen geschleift und irgendwo liegen gelassen. Mitleidige Christen leisteten ihm Erste Hilfe und sorgten für seinen Transport in das Berliner Jüdische Krankenhaus.
Über das Schicksal der während des Pogroms in die Konzentrationsläger Verschleppten waren wir zunächst nur gerüchtweise informiert. Bald aber brachte man uns die ersten Opfer aus dem Berlin naheliegenden KZ 0ranienburg-Sachsenhausen. Die Zahl dieser Einlieferungen wuchs andauernd. Zunächst wagte kaum einer von ihnen zu sprechen, geschweige denn zu erzählen, was man ihnen angetan hatte. Sie waren derart verängstigt, dass sie selbst im Bett, wenn man sie ansprach, „militärische Haltung” annahmen und Fragen lediglich mit „Ja" oder „Nein” beantworteten. Es dauerte eine ganze Weile, ehe sie sich daran gewöhnten, dass sie sich unter Juden befanden, die ihnen helfen wollten. Die akute Spitzelgefahr ließ dennoch nur sehr vorsichtige Gespräche zu. Diese Menschen hatten übrigens bei Haftentlassung durch ihre Unterschrift auf einem Formular zu bestätigen, dass sie gut behandelt worden seien. Wie „gut” die KZ-Behandlung war, konnte der Zustand der Überlebenden deutlich genug machen.
Meine diesbezüglichen ärztlichen Beobachtungen habe ich in einer ausführlichen Abhandlung niedergelegt, die 1950 in englischer Sprache in den damals in Jerusalem erschienenen Acta Medica Orientalica mit dem Untertitel „Report of an Epidemic of Hospital-Gangrene” abgedruckt wurde. Hier will ich lediglich kurz in einer für den Laien verständlichen und nervenschonenden Form darlegen, worum es sich handelte.
Die medizinischen Beobachtungen, die ich an den eingelieferten Pogrom-Haftopfern machen konnte, waren insofern von besonderer Bedeutung, als derartige Fälle in meiner langjährigen Praxis bis dahin nur ganz selten vorgekommen waren. Hier aber hatten wir es mit Massenerkrankungen zu tun. Was sich uns da offenbarte, rief Erinnerungen wach an Spitalberichte von Ärzten im Mittelalter über jene gefürchtete epidemische Wundinfektion, die, von Bett zu Bett übergreifend, allen Eindämmungsversuchen widerstand und zahllose Opfer forderte (Die einzige genaue Darstellung dieser Wundseuche in der Neuzeit ist wohl die des Kriegschirurgen Warren aus dem amerikanischen Sezessionskriege.). In das Berliner Jüdische Krankenhaus wurden etwa sechzig dieser Fälle eingeliefert. Die wirkliche Zahl muss größer gewesen sein, da sicher viele von denen, die in Oranienburg von der Seuche befallen wurden, dort vor dem Abtransport starben. Der Anblick der Unseligen ging über das hinaus, was selbst die Abgehärtetsten unter uns Ärzten und Schwestern zu ertragen gewöhnt waren. Vor allem mussten wir sie auf einer gesonderten Station unterbringen, in der wir dann Dienstschichten von je maximal drei Stunden einrichteten.
Die so erkrankten Häftlinge hatten sich ihre zunächst geringfügigen Wunden, die erst durch die totale resp. böswillige Vernachlässigung jedes Krankendienstes im Konzentrationslager schlimm wurden, meist beim Bausteineschleppen im Laufschritt, von einem Ort zum anderen und wieder zurück —‚ denn das war die übliche „Beschäftigung” im KZ — geholt. Wurden sie dann dem „diensthabenden” SS-Arzt vorgeführt, fragte der nur: „Was? Kranke Juden? — Mal sehen !” und befahl: „Arme anwinkeln, Laufschritt, marsch, marsch!” Waren dann Herzkranke tot umgefallen, fragte er noch: „Noch jemand krank?” Die Antwort war: „Nein”. Er befahl: „Abtreten”. Die „Sprechstunde” war beendet. Die im Lager mitinhaftierten Ärzte konnten der Wundinfektionen nicht Herr werden, denn man gab ihnen weder Instrumente noch Medikamente und Verbandstoff.
Hier sei rühmend der Pflegerhilfe gedacht, die den jüdischen Häftlingen von den in Oranienburg ebenfalls, nur schon viel länger, inhaftierten kommunistischen Matrosen geleistet wurde. Aber gegen die Seuche waren natürlich diese wahrhaft warmherzigen und durch ihre lange Leidenszeit schon sehr erfahrenen Helfer machtlos.
Unter den größten Schwierigkeiten beschafften wir uns das einzige gegen fortschreitenden Hautbrand wirksame Medikament — das damals vor allem für die Luftwaffe reserviert war —, durch das wir, nach dem Tod eines Drittels der Eingelieferten, die Seuche zum Stillstand bringen konnten. Wir hatten insgesamt fast ein Jahr mit den Folgen, darunter unzähligen plastischen Operationen, zu tun. Heute, nachdem wir wesentlich mehr über die Taten und Vorstellungen der Nazis wissen, darf man annehmen, dass die, an sich fast unerklärliche, Auslieferung der Seuchekranken an das Jüdische Krankenhaus in erster Linie den barbarischen Zweck verfolgte, den ja auch die Massenverhaftungen selbst gehabt haben müssen: die Auswanderung der Juden durch Schockmittel zu beschleunigen.
In der Folgezeit kamen noch viele Menschen aus Oranienburg mit charakteristischen Lagerkrankheiten zu uns. Die Lagerentlassungen setzten ein vor allem für diejenigen Häftlinge, für die man sich von draußen her verwendet hatte. Vorrang hatten die, deren Auswanderung gesichert war. Die Konsulate behandelten, wie man anerkennen muss, Visagesuche für KZ-Insassen ebenfalls mit Bevorzugung. Vorbildlich verhielt sich der Beamtenstab des Britischen Generalkonsulats in Berlin, unter Leitung von Captain Eduard Folge, der gerade zum Schutzpatron der Auswanderer wurde. Der nach ihm benannte Wald im Staate Israel ist ein würdiges Denkmal, das man der Menschlichkeit eines tapferen Freundes der Juden in schwerster Zeit gesetzt hat.
Konzentrationsläger als „Krankheitserreger” gäben Stoff genug für weitere medizinische und fachwissenschaftliche Darstellungen, die aber nicht in den unmittelbaren Zusammenhang dieses Berichtes gehören. Zahlreiche Kranke, Verstümmelte und Misshandelte passierten das Jüdische Krankenhaus Berlin, das das Behandlungszentrum für die in Deutschland verbliebenen Juden und der einzige Zufluchtsort für die vielen Leidenden, in jener traurigen Zeit doppelt Leidenden, war.
Am 22. August 1939 beendete ich meine Tätigkeit als Leiter der Chirurgischen Abteilung dieses Krankenhauses. Wenige Tage vor Beginn des zweiten Weltkrieges wanderte ich mit meiner Frau nach Palästina aus.
Was das gesamte Krankenhauspersonal damals und bis zum Ende leistete und litt, ist ein Ruhmesblatt in der Geschichte seines Berufes und der Juden Deutschlands.
Mir bleibt noch, zweier getreuer Helfer besonders zu gedenken, meines Oberarztes Dr. Fischer und meines ersten Assistenten Dr. Knopp, die Tag und Nacht neben mir wirkten, mich selbst zwar dazu ermutigten, auszuwandern, selber aber auf ihren schweren Posten ausharrten. Dr. Knopp ging untergrund und überlebte das Grauen dieser Jahre. Dr. Fischer jedoch wurde nach Theresienstadt deportiert. Kurz vor seiner Verbringung nach Auschwitz erhielten wir noch eine letzte Nachricht von ihm. Dann haben wir nie wieder von ihm gehört. Die beiden Getreuen sandten mir und meiner Frau nach meinem bewegten Abschied vom gesamten Krankenhauspersonal noch einen letzten Gruß, den ich nicht vergessen kann: Als ich mit meiner Frau in Triest die Kabine der „Galiläa” betrat, die uns in die Freiheit bringen sollte, erwartete uns dort ein großer Strauss roter Nelken. 